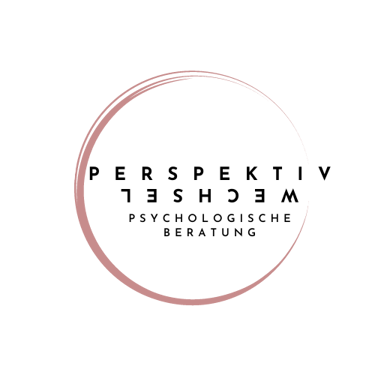Zwischen Schutz und Schmerz
Scham als menschlicher Kompass
6/22/20254 min read


Neulich durfte ich an einem interessanten Workshop mit dem Sozialwissenschaftler Dr. Stephan Marks teilnehmen – organisiert von findezukunft mit Motoki.
Thema: Scham.
Ein Gefühl, das wir meist vermeiden, verstecken oder nicht mal benennen können – dabei prägt es uns zutiefst. Dieser Workshop hat mir gezeigt, wie zentral Scham für unser Menschsein ist – und wie dringend wir einen bewussteren Umgang mit ihr brauchen.
Was ist Scham – und woher kommt sie?
Scham ist eine der ursprünglichsten menschlichen Emotionen. Sie entsteht, wenn wir das Gefühl haben, nicht zu genügen, ausgeschlossen zu sein oder unsere Integrität zu verlieren. Schon Kinder kennen Scham. Es ist kein intellektuelles Gefühl – es ist körperlich. Ein Ziehen, eine Hitze, ein innerer Rückzug.
Der Soziologe und Politikwissenschaftler Stephan Marks spricht von vier fundamentalen menschlichen Bedürfnisse, deren Verletzung Scham auslösen kann:
Zugehörigkeit
Aufmerksamkeit
Integrität
Schutz
Wenn einer dieser Bereiche bedroht ist, schaltet unser System auf Rückzug. Scham ist ein Schutzmechanismus, der unser soziales Überleben sichern soll – aber oft isoliert sie uns gerade dadurch.
Alltägliche Scham – die, über die niemand spricht
Scham begegnet uns nicht nur in großen gesellschaftlichen oder traumatischen Zusammenhängen. Sie lebt im Alltag – oft leise, aber wirkungsvoll:
Die Frau, die jahrelang ihren schwer kranken Mann gepflegt hat – liebevoll, aufopferungsvoll – und nun, nach seinem Tod, Erleichterung empfindet. Sie schämt sich dafür. „Man darf so etwas nicht fühlen“, sagt sie. Aber sie fühlt es. Und es ist menschlich.
Die Mutter, die sich schämt, weil sie sich im Alltag nach Freiheit sehnt – und manchmal nicht mehr weiß, ob sie das Muttersein erfüllt oder aufzehrt.
Der Mann, der nach einer Kündigung nicht darüber spricht, weil er sich schwach fühlt – als hätte sein Wert am Arbeitsplatz sein Menschsein definiert.
Die Frau mit Körperbehinderung, die beim Einkaufen Mitleid erntet, statt Respekt – und sich plötzlich nicht mehr als vollwertig erlebt.
Der junge Mann, der sich schämt, wenn er weint – weil er gelernt hat, dass „richtige Männer“ das nicht tun.
Solche Momente passieren überall – in Pflegezimmern, Küchen, Büros, Einkaufszentren. Sie sind nicht spektakulär, aber sie prägen, wie wir uns selbst sehen. Und oft trauen wir uns nicht, sie auszusprechen, weil wir glauben, die Scham sei unser Fehler. Dabei ist sie nur ein Zeichen dafür, dass wir fühlen.
Scham ist nicht immer „unsere“ – über Generationen und Gesellschaft
Was viele nicht wissen: Nicht jede Scham ist „selbst gemacht“. Viele unserer Schamgefühle sind übernommen – aus der Familie, der Gesellschaft oder sogar über Generationen hinweg.
1. Transgenerationale Scham
Wir tragen oft die unausgesprochenen Geschichten unserer Familien in uns. Tabus, traumatische Erlebnisse, ungelöste Schuld oder soziale Ausgrenzung hinterlassen Spuren – selbst wenn nie darüber gesprochen wurde. Diese Art von vererbter Scham zeigt sich diffus: als diffuses Unwohlsein, Rückzug, Selbstverkleinerung.
2. Gesellschaftlich vermittelte Scham
Unsere Gesellschaft produziert systematisch Scham. Indem sie bestimmte Lebensweisen, Körperformen, Herkunft, soziale Stellungen oder psychische Zustände abwertet. Wenn du „nicht funktionierst“, „nicht reinpasst“ oder von der Norm abweichst, wird oft subtil – oder offen – suggeriert: „Du bist falsch.“
Menschen in Armut wird unterstellt, sie seien „selbst schuld“.
Menschen mit Behinderung erleben, dass ihre Bedürfnisse „stören“.
Frauen, die wütend sind oder Macht beanspruchen, gelten als „unangemessen“.
Queere Menschen erfahren, dass ihre Liebe „nicht normal“ sei.
Psychisch Erkrankte schämen sich, weil sie angeblich „nicht belastbar“ sind.
Diese Scham ist nicht individuell, sondern gesellschaftlich produziert – aber sie wird individuell gespürt. Und das ist besonders perfide.
3. Minderheiten als Träger von Scham
Stephan Marks macht deutlich: Scham wird häufig auf Minderheiten projiziert.
Die dominante Gesellschaft vermeidet eigene Scham, indem sie sie auf andere überträgt. Diese werden dann zu „Trägern der Scham“. Sie tragen das, was die Mehrheit nicht anschauen will – etwa Armut, Krankheit, „Anderssein“.
So entsteht ein Mechanismus der Auslagerung: Statt kollektiv Verantwortung zu übernehmen, werden Einzelne beschämt. Besonders marginalisierte Gruppen leiden darunter. Und oft so lange, bis sie selbst glauben, dass „etwas mit ihnen nicht stimmt“.
Was Scham mit uns macht
Scham lähmt. Sie macht klein. Sie kann zu Selbstabwertung, Rückzug, Wut oder Aggression führen – denn viele sogenannte „negative Emotionen“ haben ihre Wurzeln in Scham. Sie wirkt häufig im Verborgenen. Und sie trennt uns: von uns selbst und voneinander.
Aber: Scham ist nicht nur zerstörerisch. Sie kann – wenn wir sie erkennen – auch heilsam sein. Denn sie zeigt uns, was uns wichtig ist. Wo unsere Werte verletzt werden. Wo wir uns nach Verbindung sehnen.
Ein neuer Umgang mit Scham
Was wäre, wenn wir wieder öfter sagen würden:
„Ich schäme mich gerade.“
Nicht um Mitleid zu bekommen. Sondern um ehrlich zu sein. Um in Kontakt zu treten. Um die Scham sichtbar zu machen – denn sie verliert ihre Kraft, wenn wir sie teilen können.
Scham als Teil unseres Menschseins
Stephan Marks nennt Scham die „Hüterin der Menschenwürde“. Denn sie erinnert uns daran, wie sehr wir Verbundenheit, Gesehenwerden, Schutz und Integrität brauchen. Sie zeigt uns unsere Verletzlichkeit – aber auch unsere Werte.
Scham ist nicht das Problem. Das Problem ist das Schweigen darüber.
Scham macht menschlich
Scham ist kein Zeichen von Schwäche.
Sie ist ein Zeichen dafür, dass uns etwas wichtig ist.
Dass wir dazugehören wollen.
Dass wir Mensch sind.
Lasst uns beginnen, über Scham zu sprechen.
Nicht nur im geschützten Raum eines Workshops – sondern auch im Alltag. In Beziehungen. In der Öffentlichkeit.
Denn: „Was ausgesprochen wird, verliert seine Macht.“
Danke, für das tolle Seminar und die fantastischen Gespräche, Ruben Langwara und BeatriceMüller.
Sylvia Wichmann
Mail: s.wichmann@psychologische-beratung-list.de
Telefon: 01575 2567346
Podbielskistr. 139
30177 Hannover/List
Sylvia Wichmann
Mail: s.wichmann@psychologische-beratung-list.de
Telefon: 01575 2567346
Podbielskistr. 139
30177 Hannover/List